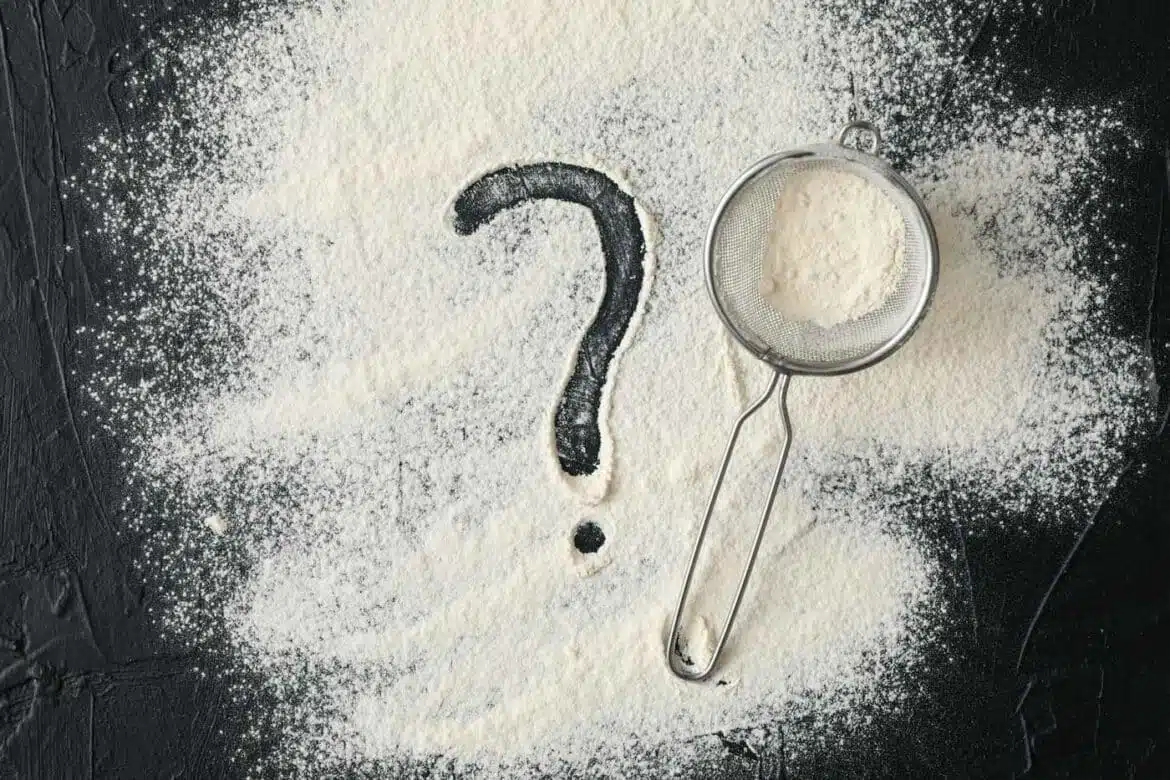Auch verfügbar auf: ![]() Français
Français ![]() English
English
Wer hätte gedacht, dass die Welt der Lebensmittel so voller überraschender und faszinierender Geschichten steckt? Von der dunklen Vergangenheit der Zitronen in Sizilien über das Geräusch wachsenden Rhabarbers bis hin zur Frage, warum manche Feigen nicht vegan sind – in diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die skurrilen, erstaunlichen und manchmal sogar humorvollen Ecken der Nahrungsmittelgeschichte. Hier sind 10 Food-Facts zum Staunen und Schmunzeln. Guten Appetit!
1. Die kriminelle Vergangenheit der Zitrone
Im 18. Und 19. Jahrhundert waren Zitronenhaine die wichtigste Einnahmequelle Siziliens. Kein Wunder also, dass alle daran mitverdienen wollten. Die Plantagen wurden oft bestohlen oder von der Konkurrenz vandalisiert. Da zu jener Zeit auf Sizilien eine schwache Rechtsstaatlichkeit herrschte, griffen die Plantagenbesitzer auf privat angeheuerte „Beschützer“ zurück, welchen sie im Gegenzug Schutzgeld bezahlten. Diese „Plantagenbeschützer“ schlossen sich schnell zu einem Netzwerk zusammen und man begann Plantagenbesitzern seine „Dienste“ unter Gewaltandrohung aufzuzwingen. Die Praxis der Schutzgelderpressung (auch als „pizzo“ bekannt) war geboren.
Aus diesen „Beschützernetzwerken“ entwickelte sich allmählich die organisierte Kriminalität, die später als die sizilianische Mafia oder „Cosa Nostra“ bekannt wurde.
2. Dem Rhabarber beim Wachsen zuhören?
In West Yorkshire, in England, befindet sich das sogenannte „Rhabarberdreieck“: Eine 23 Quadratkilometer große Fläche, auf der zur Hochzeit im 19. Jahrhundert ca. 90% des weltweiten Rhabarbers angebaut wurde. Die Bauern entwickelten zu jener Zeit die sogenannte „Forcing“ Technik, ein Vorgang, der es ermöglichte, dass der Rhabarber schneller wuchs, in größerer Anzahl zu ernten war und zudem noch süßer schmeckte. Dabei ist diese Technik – die übrigens auch heute noch verwendet wird – so erfolgreich, dass man den Rhabarber tatsächlich wachsen hören kann. Für den ganzen Lärm verantwortlich sind die sich öffnenden Knospen, die während der Vegetationsperiode ein ständiges Quietschen von sich geben.
3. Fritten der Freiheit!
Beim nächsten Fakt geht es um eine weitere Umbenennung von Lebensmittel. Interessanterweise hat es auch hier mit Frankreich und mit einem Krieg zu tun! Nämlich verurteilte die französische Regierung den Einmarsch der Vereinigten Staaten in den Irak im Jahr 2003. Daraufhin entschieden zwei Abgeordnete des amerikanischen Senats, dass in der staatlichen Cafeteria nicht länger „French Fries“ und „French Toast“ verkauft werden dürften, sondern „Freedom Fries“ und „Freedom Toast“. Obwohl die meisten Cafeteria-Mitarbeiter die Aktion (zurecht?) „völlig lächerlich“ fanden, folgten auch einige private Restaurants dem Vorbild, und änderten die Namen auf ihren Menüs. Gottseidank sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern wieder aufgetaut, und die „Freedom Fries“ sind von den Menükarten verschwunden.
4. Feigen sind nicht vegan
Feigen sind wahrscheinlich die einzigen Früchte, die streng genommen nicht vegan sind. Selbstverständlich enthalten sie kein tierisches Fleisch, allerdings fliegen bei der Bestäubung die Weibchen einer bestimmten Wespenart in die Blüten der Essfeigenbäume, aus denen sie nicht wieder herauskommen und dort verenden. Während die Blüte zur Frucht wächst, werden die Überreste der Wespe durch Enzyme zersetzt, weshalb die Frucht am Ende, genau genommen, tierisches Material enthält und folglich nicht vegan ist.
5. Das Auge isst mit!
Studien haben ergeben, dass die Farbe des Geschirrs eine direkte Auswirkung auf das Geschmackserlebnis hat! So schmecken beispielsweise rote Früchte wie Erdbeeren von einem weißen Teller süßer als von einem schwarzen. Dies liegt daran, dass durch den Farbkontrast die rote Farbe der Erdbeere stärker zum Vorschein kommt, wodurch sich das Gehirn auf einen süßeren Geschmack einstellt.
6. Lüttich oder Wien?
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren in Paris die Kaffeehäuser im Wiener Stil der letzte Schrei. Eine beliebte Kaffee-Kreation, der „Café Viennoise“, ein doppelter Espresso mit Milchschaum, Schlagsahne und Kakaopulver, benannte man in Anlehnung an die „Wiener Melange“ (die zwar weder Schlagsahne noch Kakao enthält) nach der Österreichischen Hauptstadt. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach und man sich offiziell mit dem Königreich Österreich-Ungarn im Krieg befand, benannte man die süße Kaffeemischung um zu „Café Liégeois“ um. Man entschied sich als neuen Namenspatronen für die belgische Stadt Liège, da man dort zu Beginn des Krieges der einfallenden deutschen Armee eine längere Zeit die Stirn bot und der französischen Armee einen wichtigen Zeitvorsprung verschaffte. Heute ist die Kaffeespezialität in den Pariser Cafés unter beiden Namen zu finden.
7. Mittagessen unter Kollegen verboten
Bei vielen Fluggesellschaften ist es dem Piloten und dem Co-Piloten des gleichen Flugs untersagt, die gleiche Mahlzeit zu sich zu nehmen. Diese Maßnahme dient dazu der recht unwahrscheinlichen, aber doch realen Gefahr vorzubeugen, dass beide Piloten gleichzeitig durch eine Lebensmittelvergiftung fluguntüchtig gemacht werden.
8. Bonbon-Diät
Im Jahr 2010 wollte ein Professor an der Kansas State University beweisen, dass es beim Abnehmen nicht um die Art der Nährstoffe, sondern lediglich die Kalorienanzahl entscheidend ist. Deshalb führte er ein Selbstexperiment durch und ernährte sich während 2 Monaten ausschließlich von Süßigkeiten, achtete dabei aber darauf in einem signifikanten Kaloriendefizit zu bleiben. Dabei gelang es ihm sage und schreibe 12 Kilogramm zu verlieren.
9. Das Wundermittel aus der Banane
Für die bräunliche Färbung, die die Banane beim Reifungsprozess annimmt, ist ein Protein namens „Lektin“ verantwortlich. Dieses Protein hat aber noch eine ganze Menge mehr auf dem Kasten, als die Fähigkeit, braune Flecken auf der Bananenschale zu erzeugen. Wissenschaftler der Chinese University of Hong Kong konnten nachweisen, dass Lektin die Entwicklung von Tumorzellen unterbinden und Viren daran hindern kann, sich zu vermehren. Außerdem wird auf Lektinbasis an einem Heilmittel für HIV gearbeitet.
10. Keine Suppe beim US-Präsidenten
Nachdem der damalige US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1969 den Premierminister von Kanada auf Staatsbesuch hatte, beschwerte er sich bei seinem Stabschef, dass das Essen ihm viel zu lange dauern würde. Er schlug vor, dieses in Zukunft, um einen Gang zu kürzen. Man solle doch einfach die Suppe weglassen. Nixons Stabschef Bob Haldeman vermutete jedoch einen anderen Grund als die lange Zeitdauer. Er bemerkte, dass der Präsident sich mit der Suppe bekleckert hatte. Das ist Nixon wohl so peinlich gewesen, dass es für den Rest seiner Amtszeit keine Suppe mehr bei Staatsbesuchen gab.